
Lage. Dem Rat der Stadt liegt die Petition eines niedersächsischen Bürgers vor, die Hindenburgstraße in Lage umzubenennen. Jeder hat nach Artikel 17 des Grundgesetzes das Recht, einen solchen Antrag zu stellen, auch wenn er nicht in der betroffenen Stadt lebt.
Der Hauptausschuss folgte mit großer Mehrheit dem Vorschlag der Verwaltung, das Begehren der Petition abzulehnen und den Straßennamen im Abschnitt der B66 so beizubehalten.
„Die Stadt Lage verkennt im geschichtlichen Rückblick nicht die prägende Rolle der Person ‚Paul von Hindenburg‘, insbesondere als Chef der Obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg sowie als Reichspräsident beim Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland“, heißt es in der Beschlussvorlage.
Warum dann nicht umbenennen? „Die Beibehaltung der Straßenbenennung gibt den Anlass für eine bewusste kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts im Allgemeinen und einem Wegbereiter beim Aufstieg des Nationalsozialismus im Besonderen. Dafür soll das Straßenschild mit einem QR-Code ergänzt werden, der auf vertiefende Informationen zum Namensgeber verweist.“
Das also ist die vorgeschlagene Lösung: Das Straßenschild mit einem QR-Code-Link versehen, der im Internet zu weiterführenden Informationen führt. Ein Kompromiss, der in vielen Städten beim Umgang mit problematisch gewordenen Straßennamen angewendet wird. Mit 13 gegen drei Stimmen sprachen sich die Mitglieder des Hauptausschusses für diese Lösung aus. Damit kann der Wunsch zur Umbenennung als abgelehnt gelten, da ein eindeutiges Hauptausschuss-Votum die nachfolgende Ratsentscheidung in der Regel präjudiziert.
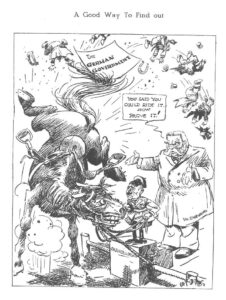
CDU-Fraktionschef Michael Biermann machte aus seiner Verachtung für den „Steigbügelhalter Hitlers“, den er als „Totengräber der Weimarer Republik“ bezeichnete, keinen Hehl. Mit Straßennamen sollte man Menschen ehren, die das auch verdienen, argumentierte er. Trotzdem folge seine Fraktion dem Verwaltungsvorschlag „schweren Herzens“.
Hans Hofste (SPD) schloss sich Biermanns Argumentation direkt an. Martina Hannen (FDP) – „Hindenburg war unstrittig Steigbügelhalter Hitlers“ – betonte den Gedanken, dass man Geschichte nicht einfach „glattbügeln“ dürfe. „Geschichtsklitterung“ nehme gerade jungen Menschen die Chance, sich mit dem, was gewesen ist, kritisch auseinanderzusetzen.
Nur Monika Beckmann bezog als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen die Position, die Petition anzuerkennen und den Verwaltungsvorschlag abzulehnen. „Die Umbenennung der Hindenburgstraße würde die Chance bieten, ein Zeichen für unsere Erinnerungskultur zu setzen, die ein zeitgemäßes und demokratisches Geschichtsverständnis widerspiegelt.“
Ihrem Argument, dass Hindenburg auch für die Ermordung von Millionen Juden verantwortlich sei, widersprach Bürgermeister Matthias Kalkreuter mit dem Hinweis auf Hindenburgs Sterbedatum: 2. August 1934. Hindenburg habe Hitler mit der Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 zwar an die Macht gebracht und damit den Aufstieg des Nationalsozialismus ermöglicht, aber für die Vernichtungspläne der Nazis könne Hindenburg nicht verantwortlich gemacht werden, auch wenn die Lektüre des Hitler-Buches „Mein Kampf“ solches hätte erahnen lassen.
Uwe Detert (AfD) bedankte sich beim Bürgermeister ausdrücklich für diese historische Klarstellung und lehnte eine Umbenennung der Hindenburgstraße in der Argumentationslinie seiner Vorredner von CDU, SPD und FDP ab. Auch die kleineren Parteien FWG/BBL schlossen sich dem Kompromissvorschlag „QR-Code an Straßenschild“ an.
In Deutschland gibt es so viele Hindenburgstraßen, Hindenburgringe, Hindenburgdämme, dass ihre Zahl nur schwer zu ermitteln ist. Vor allem, weil in den vergangenen Jahren viele Städte und Gemeinden aufgrund der historischen Rolle des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg (1847 – 1934) beschlossen haben, solche Straßennamen umzubenennen.
So heißt zum Beispiel die Straße in Hannover jetzt Loebensteinstraße nach der Tochter des jüdischen Bankiers Herbert Loebenstein. Nach der Flucht der Familie vor den Nazis in die Niederlande wurden Lotte-Lore Loebenstein (geboren 1932) und ihre Eltern 1943 verhaftet und im Vernichtungslager Sobibor ermordet.










